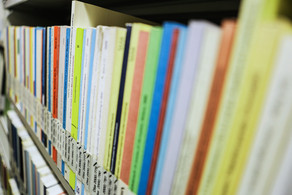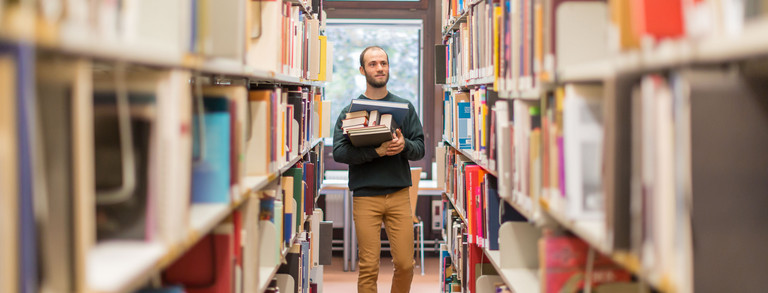Praktische Theologie & Religionspädagogik
Die Praktische Theologie/Religionspädagogik beschäftigt sich als wissenschaftliche Disziplin mit Fragen gelebter und gelehrter Religion. Sie untersucht im Besonderen wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich Religion unter den Bedingungen einer pluralisierten Gesellschaft lebensweltlich aneignen, welche Bildungsaufgaben sich daraus ergeben und wie diese im Unterricht und an anderen Lernorten, wie Gemeinde, Kultur, Medien, bearbeitet werden können. Zu diesem Zweck greift die Praktische Theologie/Religionspädagogik auf ein breites Methodenrepertoire zurück, das sowohl Methoden der empirischen Sozial- und Unterrichtsforschung, der Hermeneutik, als auch der systematischen Normbegründung umfasst. Zugleich ist die Religionspädagogik dadurch auch inhaltlich grundlegend interdisziplinär ausgerichtet. Ziel ist die Erarbeitung und Diskussion religionspädagogischer Theorien, die pastorales und unterrichtliches Handeln orientieren.
Professur für Praktische Theologie
An der Professur für Praktische Theologie werden in der Forschung Schwerpunkte auf religionspädagogische Fragestellungen gelegt und religiöse Bildungsprozesse an schulischen und außerschulischen Lernorten fokussiert. Dabei werden die Themen weitgehend interdisziplinär bearbeitet, wobei insbesondere der Dialog mit der Kunstwissenschaft, den Erziehungswissenschaften sowie der kritischen und politischen Bildung gesucht wird. Methodisch werden sowohl hermeneutische als auch qualitativ-empirische Ansätze angewandt. Folgende Themenschwerpunkte stehen derzeit im Fokus.
Die Erforschung von Funktionen und Wirkungen von Kunst in religiöser Bildung zählt zu den zentralen Arbeitsfeldern an der Professur. Derzeit werden zwei Themen drittmittelgestützt untersucht:
-
Erforschung und Entwicklung heterogenitätssensibler Lernprozesse mit Kunst im Religionsunterricht. Eine empirische Untersuchung adaptiven Lernens (DFG-finanziert; mit Prof. Dr. Britta Konz, Universität Mainz)
-
„Gegenstände religiöser Bildung und Praxis – Funktion und Gebrauch von materiellen Objekten und Artefakten in exemplarischen Räumen“. (DFG-Netzwerk mit Prof. Dr. Antja Roggenkamp, Münster/Prof. Dr. Sonja Keller, Neuendettelsau).
Um religiöse Lernprozesse heterogenitätssensibel und gezielt initiieren zu können, gelten Diagnosekompetenzen als Schlüsselkompetenzen und stellen daher einen zentralen Bestandteil der Lehrkräfteprofessionalität dar. Dennoch ist in der Religionsdidaktik das Verständnis von Diagnosekompetenz bislang erst unscharf konturiert, empirische Erhebungen hierzu fehlen weitgehend. Im Rahmen dieses Forschungsschwerpunkts wird derzeit drittmittelgestützt untersucht:
DiaLeRu - Diagnostik heterogener Lernvoraussetzungen im Religionsunterricht
In diesem Forschungsschwerpunkt wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag eine Religionspädagogik angesichts der ökologischen Krise im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten kann. Dabei wird die ökologische Krise als Teil einer multiplen Krise gedeutet, die nicht allein durch individuelles Handeln, sondern politisch und gesellschaftlich bewältigt werden muss. In diesem Forschungsschwerpunkt wird daher erarbeitet, wie religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung als eine dezidiert politisch dimensionierte ausgerichtet sein und dabei auch Lernende berücksichtigen kann, die notwendigen sozial-ökologischen Transformationen skeptisch gegenüberstehen. Derzeit werden drei Schwerpunkte erforscht.
- Grundlagen und Prinzipien einer religiösen BNE
- DFG-Projekt: Religiöse BNE. Empirische Erforschung ihrer Wirkung auf das geplante umweltbewusste Verhalten von Haupt- und Sekundarschüler*innen
- Religiöse Narrationen in neurechten Naturschutzdiskurse
- Christlich-muslimische Forschung zu Fragen der sozial-ökologischen Transformation
Das Thema wird in enger Zusammenarbeit mit der AKRK-Arbeitsgruppe „Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erforscht.
Im Rahmen der Fachdidaktischen Entwicklungsforschung werden unterrichtsnahe Projekte durchgeführt mit dem Ziel, sowohl konkrete Lernsettings zu entwickeln als auch die fachdidaktische Theoriebildung voranzutreiben.
Obwohl die Religionspädagogik weitgehend hermeneutisch ausgerichtet ist und erst in den letzten Jahren verstärkt auch empirische Methoden angewandt werden, sind methodologische Reflexionen hermeneutischen Arbeitens in der Religionspädagogik rar. Zusammen mit Wissenschaftler*innen der evangelischen, katholischen und islamischen Religionspädagogik werden in diesem Forschungsschwerpunkt Fragen nach der fachspezifischen Fundierung religionspädagogisch-hermeneutischer Forschung reflektiert, forschungsmethodische Zugänge in Hinblick auf ihre interdisziplinäre Anschlussfähigkeit diskutiert und die Ergebnisse in einem Handbuch publiziert. Das Projekt wird von der DFG gefördert (Laufzeit 2021-2024).
Aktuelle Drittmittelprojekte
- DiaLeRu - Diagnostik heterogener Lernvoraussetzungen im Religionsunterricht
- REBiNe - Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung. Empirische Erforschung ihrer Wirkung auf das geplante umweltbewusste Verhalten von Haupt- und Sekundarschüler*innen
- Hekuru – Heterogenitätssensibles Lernen mit Kunst im Religionsunterricht
- Klimaskepsis intersektional
- Dimensionen religionspädagogisch-hermeneutischer Forschung. Methodologische und forschungsmethodische Fundierungen
Professur für Religionsdidaktik
An der Dortmunder Professur für Katholische Theologie und Religionsdidaktik wird der Ansatz einer empirisch orientierten Religionsdidaktik vertreten. Schwerpunktmäßig werden in Forschungsprojekten empirische Methoden eingesetzt und weiterentwickelt, um detaillierte Kenntnisse über Lehr- und Lernprozesse zu gewinnen. Diese Kenntnisse werden als eine Grundlage dafür gesehen, relevante Sinnzusammenhänge zu verstehen (Hermeneutik) und Bildungsziele adäquat zu begründen.
Forschungsschwerpunkte
Während in den letzten Jahrzehnten das Pluralitätsparadigma innerhalb der Religionsdidaktik zu einer Fülle von Forschungsprojekten und didaktischen Entwürfen geführt hat, sind Fragen der sozialen Benachteiligung, der Heterogenität und der Milieuverengung im Religionsunterricht wenig thematisiert worden. Der erste Forschungsschwerpunkt fragt danach, wie ungleiche Lernbedingung im Religionsunterricht entstehen, inwiefern der gegenwärtige Religionsunterricht die soziale und kulturelle Heterogenität der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und welche didaktischen Strategien dazu geeignet sind, ungleiche Lernbedingungen zu überwinden.
Publikationen:
- Unser, A. (2022). Social inequality in religious education: Examining the impact of sex, socioeconomic status, and religious socialisation on unequal learning opportunities. Religions, 13(5), 389
- Unser, A. (Ed.) (2022). Special Issue: Social inequality and heterogeneity in religious education. Religions.
- Unser, A. (2019). Social inequality and interreligious learning: An empirical analysis of students` agency to cope with interreligious learning tasks. Wien: LIT.
- Unser, A. (2016). Soziale Ungleichheiten im Religionsunterricht: Eine quantitativ-empirische Untersuchung mit Blick auf die religionspädagogische Debatte um Bildungsgerechtigkeit. In B. Grümme & T. Schlag (Eds.), Gerechter Religionsunterricht? Religionspädagogische, pädagogische und sozialethische Orientierungen (pp. 80-95). Stuttgart: Kohlhammer.
- Unser, A. (2014). Wie kann sich Religionspädagogik von Bildungsgerechtigkeit herausfordern lassen? Eine Entgegnung auf Judith Könemann. Religionspädagogische Beiträge, 71, 17-25.
Religiöse Pluralität gilt vielen als eine der zentralen Herausforderungen heutigen Zusammenlebens. Seit über 30 Jahren wird daher in der Religionspädagogik an Ansätzen des interreligiösen Lernens gearbeitet, um Schülerinnen und Schüler optimal auf eine religionsplurale Gesellschaft vorzubereiten. Der zweite Forschungsschwerpunkt untersucht, welche Lehr-Lern-Arrangements des interreligiösen Lernens tatsächlich zu Lerneffekten führen und wie gut diese auf eine heterogene Schüler*innenschaft angepasst sind. So werden auch neue, innovative Lehr-Lernformen entwickelt und erprobt.
Publikationen:
- Unser, A. (2022). Die Konstruktion der Wirksamkeit interreligiösen Lernens zwischen didaktischer Theorie und empirischer Unterrichtsforschung. In N. Brieden, H. Mendl, O. Reis & H. Roose (Hg.), Nachhaltige Wirkung von Religionsunterricht (pp. 46-57). Babenhausen: LUSA.
- Unser, A. (2022). Über Möglichkeiten und Grenzen des Abbaus von Vorurteilen und Stereotypen durch interreligiöses Lernen. In M. Khorchide, K. Lindner, A. Roggenkamp, C. P. Sajak & H. Simojoki (Eds.), Stereotypen - Vorurteile - Ressentiments: Herausforderungen für das interreligiöse Lernen (pp. 147-164). Göttingen: V&R unipress.
- Unser, A. (2022). Entwicklungspsychologie, interreligiös. In M. Zimmermann & H. Lindner (Eds.), Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon im Internet, www.wirelex.de
- Unser, A. (2021). Forschung, empirische, interreligiös. In M. Zimmermann & H. Lindner (Eds.), Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon im Internet, www.wirelex.de
- Unser, A. (2021). Interreligiöses Lernen. In U. Kropač & U. Riegel (Eds.), Handbuch Religionsdidaktik (pp. 280-291). Stuttgart: Kohlhammer.
- Unser, A. (2019). Social inequality and interreligious learning: An empirical analysis of students` agency to cope with interreligious learning tasks. Wien: LIT.
- Unser, A. (2018). Is religious experience necessary for interreligious learning? An empirical critique of a didactical assumption. In U. Riegel, E.-M. Leven & D. Fleming (Eds.), Religious experience and experiencing religion in religious education (pp. 97-115). Münster: Waxmann.
- Unser, A. (2018). Interreligiöses Lernen. In M. Schambeck & U. Riegel (Eds.), Was im Religionsunterricht so läuft: Wege und Ergebnisse religionspädagogischer Unterrichtsforschung (pp. 270-285). Freiburg: Herder.
Die Frage danach, ob Religion und Religiosität für das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen in einer liberalen Demokratie eher förderlich oder eher hinderlich sind, wird wissenschaftlich kontrovers diskutiert. Es lassen sich sowohl Befunde anführen, die Religion und Religiosität einen positiven Einfluss auf das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern zuschreiben, während andere Studien auf mögliche demokratiehemmende Auswirkungen hinweisen. Der dritte Forschungsschwerpunkt zielt darauf ab zu rekonstruieren, unter welchen kontextuellen Bedingungen Religion und Religiosität fördernde oder hemmende Auswirkungen auf das Zusammenleben in Demokratien entfalten und in welchen lebensweltlichen Zusammenhängen Kinder und Jugendliche eine demokratiefördernde bzw. -hemmende Religiosität entwickeln.
Publikationen:
- Unser, A. (Ed.) (2022). Religion, citizenship and democracy. Cham: Springer.
- Fumbo, C., & Unser, A. (2022). The contribution of religion to the promotion of critical citizenship: An empirical study among young people in Tanzania. In A. Unser (Ed.), Religion, citizenship and democracy (pp. 117-133). Cham: Springer.
- Unser, A., & Ziebertz, H.-G. (2020). The impact of religion and national origin on attitudes towards refugee rights: An international comparative empirical study. Religions, 11 (6), 303.
- Ziebertz, H.-G., & Unser, A. (2020). The prohibition of discrimination and unequal treatment of women and homosexuals: An empirical comparative research considering the influence of religion and nation. Journal of Empirical Theology, 33 (2), 1-35.
- Unser, A., Döhnert, S., & Ziebertz, H.-G. (2018). Attitudes towards refugee rights in thirteen countries: A multi-level analysis of the impact and interaction of individual and sociocultural predictors. In C. Sterkens & H.-G. Ziebertz (Eds.), Political and judicial rights through the prism of religious belief (pp. 275-302). Cham: Springer.
- Unser, A., Zviadadze, S., Döhnert, S., Shupac, M., & Ziebertz, H.-G. (2020). Predictors of attitudes towards the right to work: An empirical analysis among young people in Moldova and Georgia. In H.-G. Ziebertz (Ed.), International empirical studies on religion and socioeconomic human rights (pp. 129-168). Cham: Springer.
- Ziebertz, H.-G., Döhnert, S., & Unser, A. (2017). Predictors of attitudes towards human dignity: An empirical analysis among youth in Germany. In H.-G. Ziebertz & C. Sterkens (Eds.), Religion and civil human rights in empirical perspective (pp. 17-60). Cham u. a. Springer.
- Ziebertz, H.-G., Unser, A., Döhnert, S., & Sjöborg, A. (2017). The influence of the sociocultural environment and personality on attitudes towards human rights: An empirical analysis in reference to human rights education, A. Sjöborg & H.-G. Ziebertz (Eds.), Religion, education and human rights: Theoretical and empirical perspectives (pp. 139-164). Cham: Springer.
- Unser, A., Döhnert, S., & Ziebertz, H.-G. (2015). The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards civil human rights. In H.-G. Ziebertz & E. Hirsch Ballin (Eds.), Freedom of religion in the 21st Century: A human rights perspective on the relation between politics and religion (pp. 130-161). Leiden: Brill.
- Unser, A., & Ziebertz, H.-G. (2015). Human rights and religion in Germany. In H.-G. Ziebertz & G. Črpić (Eds.), Religion and human rights: An international perspective (pp. 61-83). Cham: Springer.
Aktuelle Drittmittelprojekte
- BMBF-Anschubfinanzierung für Antragsvorbereitung im Rahmen der EU-Förderlinie „Horizon Europe“ (Work Programme 2023 – 2024)
- Kontroverse Themen im konfessionellen Religionsunterricht – Fragebogenstudie mit Religionslehrkräften (Prestudy)
- Kontroverse Themen im konfessionellen Religionsunterricht – Fragebogenstudie mit Religionslehrkräften (KoTheRu)
- Zusammenhalt in Europa durch Religion (ZER)
- Religion and Citizenship (ReaC)
- Potenzialanalyse für den Zukunftsprozess des kfd Bundesverbands e.V.
- Diagnostik heterogener Lernvoraussetzungen im Religionsunterricht (DiaLeRu)
- DivKom – Diversität in Kommunalverwaltungen